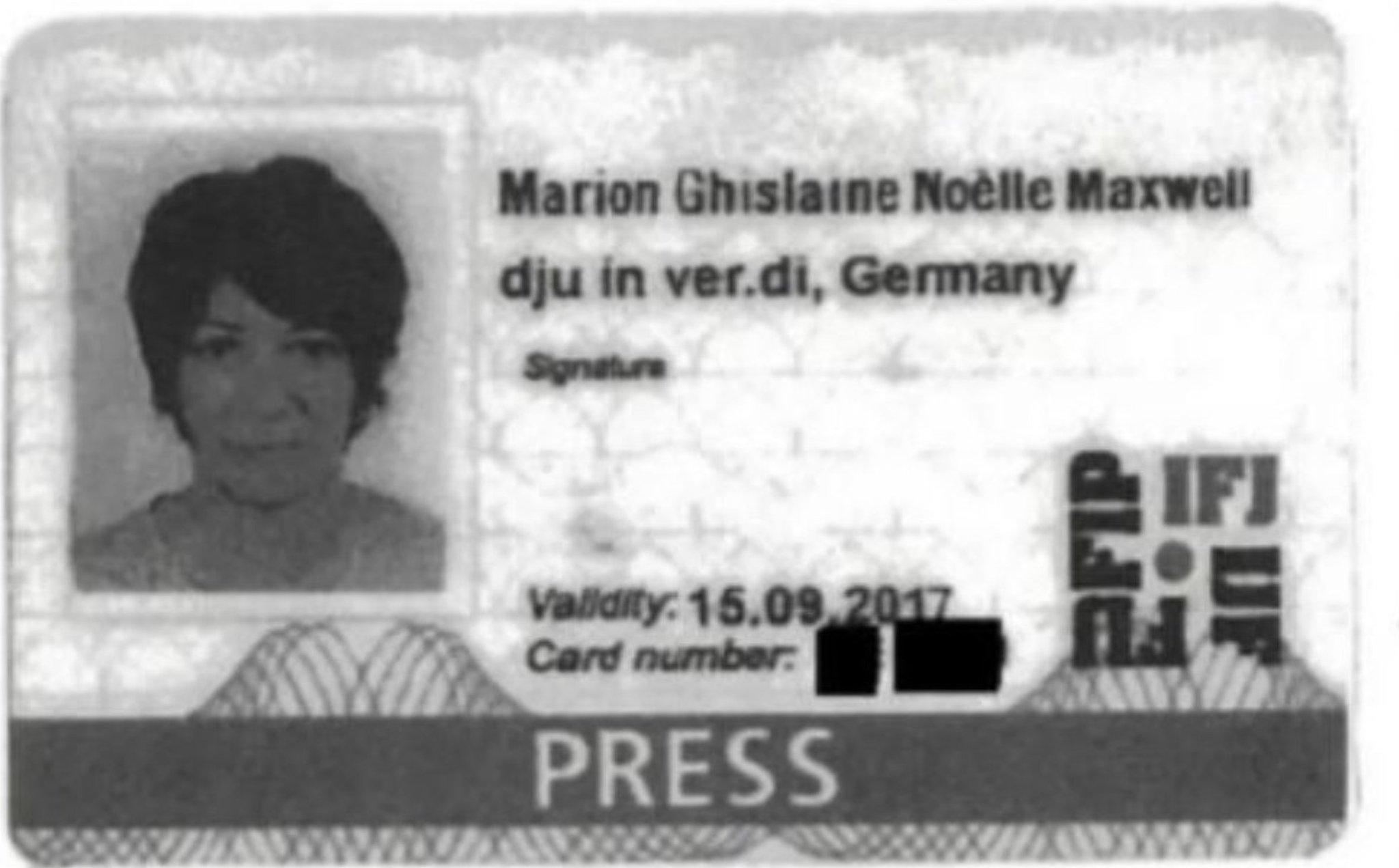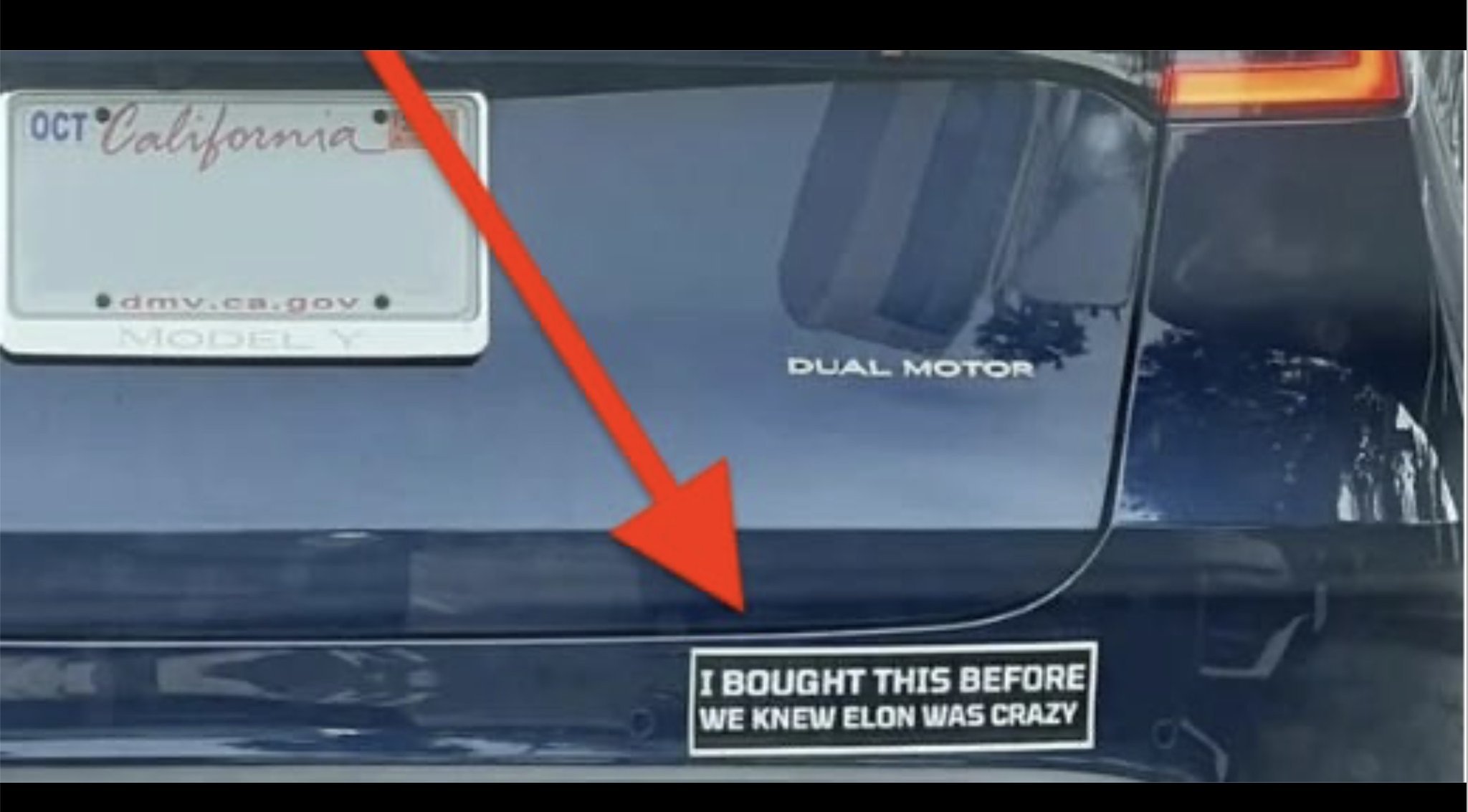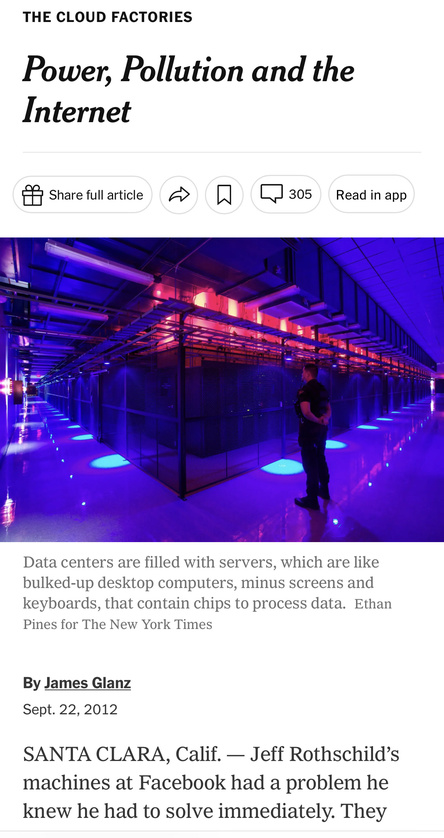Dass die Mühlen der Justiz langsam mahlen, ist bekannt. Wie sie mahlen und was die Konsequenzen sind, kann man jetzt an den Urteilen ablesen, die sich mit den Corona-Massnahmen beschäftigen. Man erinnere sich: Im Zuge der Ausbreitung der ersten Corona-Welle Anfang 2020 erfolgte auch in der westlichen Welt eine weitreichende Einschränkung von Grundrechten und eine Regulierung des sozialen Lebens mit Kontrollen bis weit in die Privatsphäre hinein.
Es mag der verbreiteten Verunsicherung und Panik zuzuschreiben sein, dass solche Eingriffe nicht zu grösserer Empörung geführt haben und die Gerichte, so sie denn angerufen wurden, sich entweder für nicht zuständig erklärten oder wenig Beanstandenswertes festzustellen vermochten.
Fragt man sich, wie aus heutiger Sicht die Beurteilung der Massnahmen aussieht, so fällt nicht nur auf, dass die Gerichte die Grundrechtseinschränkungen nach wie vor für rechtens halten, sondern auch, dass sie dabei eine Rechtsposition einnehmen, die das Potenzial hat, unsere Rechtsstaaten in ihren Grundfesten zu erschüttern.
Dies lässt sich an einschlägigen Urteilen der letzten Zeit aufzeigen – etwa an einem Bundesgerichtsentscheid zur Testpflicht von nichtgeimpftem Personal in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. Beschwerde eingereicht hatten Mitarbeitende dieser Einrichtungen im Tessin, welche sich gegenüber ihren geimpften Kollegen diskriminiert sahen.
Das Bundesgericht hatte zu beurteilen, ob es mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar war, die Nichtgeimpften zu Corona-Tests zu zwingen, obwohl bereits zum Zeitpunkt der Anordnung der Testpflicht ersichtlich war, dass eine Impfung keinen Fremdschutz gewährleistet, also auch Geimpfte das Virus weiterverbreiten können.
Der Entscheid des Bundesgerichts geht nun in keiner Weise auf die Sachargumentation der Kläger ein, sondern weist deren Beschwerde unter anderem mit Verweis auf das Epidemiengesetz ab. Bedenklich an diesem Urteil ist, dass das oberste Gericht seine Rechtsfindung damit auf die bescheidene Aufgabe der Gesetzeslesung beschränkt, statt zu der juristisch wesentlichen Frage vorzudringen. Das Gesetz lesen kann jedoch jeder Bürger selbst. Und dass im Artikel 40 des Epidemiengesetzes, auf welchen das Bundesgericht verweist, die Kantonsbehörden ermächtigt werden, den Zugang zu den Einrichtungen zu regulieren, wussten die Beschwerdeführer auch. Worum es ihnen aber ging, nämlich um eine rechtssystematische Prüfung, ob diese Anwendung des zugrunde liegenden Gesetzes durch die kantonalen Behörden rechtmässig war, das wurde hier nicht geleistet. Rechtsphilosophisch bedeutet das die Eingrenzung der dritten Staatsgewalt auf einen rechtspositivistischen Automatismus: Man schafft so das naturrechtliche Fundament, das allein Staaten zu Rechtsstaaten macht, ab. Ein nur formal korrekt beschlossenes und angewendetes positives Recht gibt es auch in Unrechtsstaaten.
Konkret versagt das Bundesgericht in seiner richterlichen Urteilskraft bei der Beurteilung, ob die Behörden das Gesetz verhältnismässig angewendet haben. Ähnlich hatte auch das deutsche Bundesverfassungsgericht auf eine Klage von Pflegekräften reagiert, von denen am Arbeitsplatz ein Impfnachweis verlangt wurde.
Die Richter stellten zwar fest, dass die Impfpflicht in die vom Grundgesetz «geschützte körperliche Unversehrtheit» eingreife, dieser Eingriff jedoch verfassungsrechtlich legitim sei. Auch die im Grundgesetz garantierte Berufsfreiheit sah das Gericht nicht verletzt, obgleich es – die eigene Aussage im tatsächlichen Ergebnis ad absurdum führend – betont, dass das Infektionsschutzgesetz ein Tätigkeitsverbot abstützen könne. So erhielten die freigestellten Pflegekräfte von dem obersten Gericht bestätigt, dass sie ihr Recht der Berufsausübung durch das Impfgesetz verloren haben, dieser Verlust aber rechtens sei.
Solche Schlüsse treten auf, wenn die obersten Gerichte nicht mehr die Kraft aufbringen, die Anwendung der Gesetze auf ihr Fundament zu überprüfen: Lagen im konkreten Fall tatsächlich Umstände vor, die eine Einschränkung der Grundrechte als gerechtfertigt erweisen? Waren die Anordnungen der Behörden der Situation angemessen und somit verhältnismässig?
Wenn die Gerichte solche Fragen nicht unabhängig und ergebnisoffen untersuchen, reduzieren sie ihre Aufgabe auf die Lektüre der Gesetze. Damit machen sich die Gerichte als relevante Staatsgewalt überflüssig und liefern die Bürger wie ein blosser Subsumptionsautomat der Willkür der behördlichen Auslegung von Gesetzen aus.
Andreas Brenner ist Professor für Philosophie an der Universität Basel, zuletzt von ihm erschienen: «CoronaSoma. Leib in Zeiten der Pandemie». Michael Esfeld ist Professor für Philosophie an der Universität Lausanne, zuletzt von ihm erschienen: «Und die Freiheit? Wie die Corona-Politik und der Missbrauch der Wissenschaft unsere offene Gesellschaft bedrohen» (gemeinsam mit Christoph Lütge).